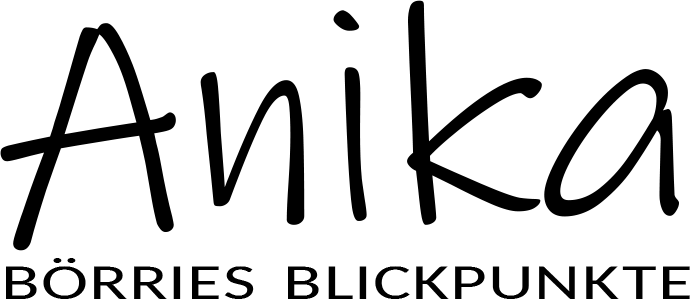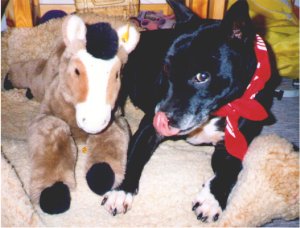Welt in Unordnung – warum wir wieder über Aufklärung sprechen sollten
In einer Zeit, in der Spannungen wachsen, Toleranz schwindet und sich Macht immer mehr konzentriert, lohnt sich ein Blick zurück in die Aufklärung – zu zwei Denkern, deren Ideen heute aktueller sind denn je: François-Marie Arouet Voltaire (1694 – 1778), Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu (1689 – 1755) und Immanuel Kant (1724 – 1804). Ihre Schriften sind keine verstaubte Philosophiegeschichte, sondern lebendige Denkanstöße für unsere Gegenwart.
Blick in die Gegenwart – und ins Unbehagen
Manchmal hat man das Gefühl, es wackelt grundlegend: Nicht nur kleine Krisen, sondern das Fundament unserer Gesellschaft – Freiheit, Toleranz, Rechtsstaat – bekommt Risse.
In Russland herrscht eiserne Hand, in China kontrolliert die Partei selbst Gedanken, in den USA untergräbt Populismus demokratische Institutionen, im Iran wird die Bevölkerung unterdrückt, in Israel radikalisiert sich die Politik, und auch in Ungarn, Rumänien, Österreich oder den Niederlanden, wo rechtspopulistische Bewegungen zunehmend Einfluss auf den politischen Diskurs nehmen, lösen sich liberal-demokratische Werte auf. Die Liste könnte man noch fortsetzen.
Dazu kommt eine wachsende Spaltung innerhalb der Gesellschaften selbst: Hetze gegen Flüchtlinge, antidemokratischer Rhetorik und dem Ruf nach „einfachen“ Lösungen durch starke Führer. Viele Menschen fühlen sich überfordert – und hoffen auf Ordnung durch autoritäres Durchgreifen. Aber genau hier liegt der Trugschluss: Stabilität ohne Freiheit ist kein Fortschritt, sondern Rückschritt. Wie Benjamin Franklin (1706–1790) schon sagte:
Wer grundlegende Freiheit aufgibt, um ein wenig vorübergehende Sicherheit zu gewinnen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit.
Franklin
In einer Zeit, in der moralische Beliebigkeit oft als Freiheit missverstanden wird, lohnt sich der Blick zurück auf Kant:
Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
Kant
Aufklärung heißt: Verantwortung – für das eigene Denken wie für das eigene Tun.
Freiheit durch Toleranz und Verstand – Voltaires Vermächtnis
Voltaire war einer, der sich getraut hat, unbequem zu sein. Ein scharfer Kritiker des Fanatismus. Ein Verteidiger der Vernunft. Er glaubte an die Kraft des Wortes – und daran, dass Gesellschaft nur frei sein kann, wenn unterschiedliche Meinungen nebeneinander existieren dürfen. Ein Satz, der oft mit ihm verbunden wird, stammt zwar von der Schriftstellerin Evelyn Beatrice Hall (1868-1956), bringt aber Voltaires Haltung auf den Punkt:
Ich verabscheue, was du sagst, aber ich werde dein Recht, es zu sagen, bis zum Tod verteidigen.
Hall
In einer Welt, in der Menschen für ihre Meinung bedroht, diffamiert oder zensiert werden – online wie offline – ist das kein historisches Relikt, sondern ein Prüfstein.
Voltaires Werk Traité sur la tolérance – Aufrufe zur Toleranz (1763) enthält Gedanken, die heute fast erschreckend aktuell wirken:
Was ist Toleranz? Sie ist die Folge der Menschlichkeit. Wir sind alle voller Irrtümer und Schwächen; verzeihen wir einander unsere Torheiten – das ist das erste Gesetz der Natur.
Voltaire
Und weiter:
Lasst uns Toleranz üben, damit wir in Frieden leben können – auch wenn wir verschieden glauben.
Und:
Jede Religion, die verfolgt, ist falsch. Jede Religion, die duldet, ist weise.
Voltaire
Voltaires Botschaft ist klar: Gesellschaft wird nicht stark durch Rechthaben, sondern durch die Fähigkeit, Unterschiedlichkeit auszuhalten.
Macht braucht Kontrolle – Montesquieus Warnung
Montesquieu ist vielleicht nicht der eingängigste Name in Talkshows, aber seine Ideen sind das Rückgrat unserer Verfassungen. Er brachte auf den Punkt, was heute manchmal in Vergessenheit gerät:
Es ist eine ewige Erfahrung, dass jeder Mensch, der Macht hat, dazu getrieben wird, sie zu missbrauchen.“
Montesquieu
Darum brauchen wir Gewaltenteilung: Legislative, Exekutive, Judikative. Nicht als leere Formalie, sondern als Schutzmechanismus, damit niemand über Regeln hinwegregiert.
Wenn Gerichte politisiert, Parlamente geschwächt oder Medien unter Druck gesetzt werden, dann geht es ans Eingemachte. Was wir in Polen, Ungarn, Israel oder den USA sehen, sollte Warnung genug sein: Ohne Kontrolle der Macht schwindet die Freiheit.
Warum wir heute wieder auf die Aufklärung hören sollten
Voltaire und Montesquieu erinnern uns an etwas, das man nicht oft genug wiederholen kann:
Freiheit, Toleranz, Menschenwürde, Rechtsstaat sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern fragile Errungenschaften. Und wie alle Errungenschaften: verletzlich.
Doch Halt im Autoritären zu suchen, ist Irrtum. Die Antwort liegt nicht in mehr Härte, sondern in mehr Vernunft. Nicht im Lautsein, sondern im Zuhören. Nicht im Kontrollieren, sondern im Verstehen. Denn Aufklärung bedeutet nicht nur Wissen, sondern vor allem:
Den Mut, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen!
Kant
Ein Leitsatz, der heute wieder hell leuchten darf.
Die Aufklärung ist kein historisches Kapitel – sie ist ein Auftrag
Voltaire und Montesquieu haben keine Gebrauchsanweisung für unsere Zeit geschrieben. Aber sie gaben uns Werkzeuge: den Wert des Nachdenkens, die Kraft der Sprache, die Notwendigkeit, Macht zu begrenzen.
Die Aufklärung war nie nur ein philosophisches Projekt. Sie war der Anfang einer Entwicklung, das unser Leben bis heute prägt. Ohne sie gäbe es keine freie Wissenschaft, keine Bildung für alle, keine sozialen Aufstiege durch Leistung, keine technischen Erfindungen, die unseren Alltag erleichtern. Freiheit und Bildung sind keine Luxusgüter – sie sind das Fundament unseres Wohlstands. Ohne sie wäre unsere Gesellschaft starrer, undurchlässiger, ungerechter. Geregelte Arbeitszeiten, soziale Sicherheit, wirtschaftlicher Fortschritt – auch das verdanken wir der Aufklärung. Wer meint, man könne auf diese Prinzipien verzichten, um Sicherheit zu gewinnen, der vergisst: Auch technischer Fortschritt, Innovation und Demokratie brauchen Freiheit wie die Luft zum Atmen.
Die Ideen Voltaires und Montesquieus leben nicht nur in Büchern weiter – sie stecken in den Grundprinzipien unserer Verfassung: Meinungsfreiheit, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit. Aber sie bleiben nicht durch Papier lebendig – sondern nur, wenn wir bereit sind, sie jeden Tag neu mit Leben zu füllen.
Wenn wir heute über Demokratie sprechen, über Werte, über Zusammenhalt – dann sollten wir nicht so tun, als wäre all das selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich. Es hängt davon ab, ob wir bereit sind, es zu schützen.
Nicht akademisch. Sondern praktisch. Politisch. Menschlich. Jetzt.