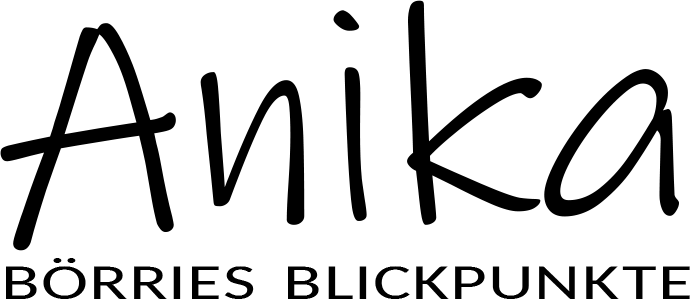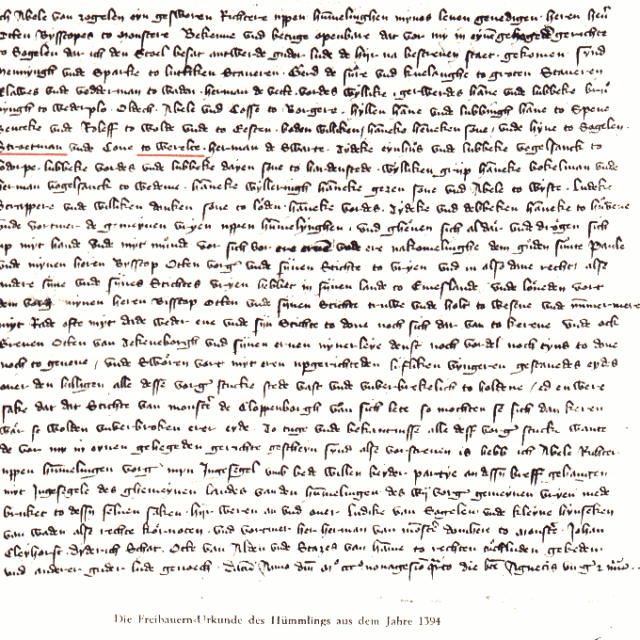Das Heuerwesen
Auf dem Hümmling galt traditionell das Anerbenrecht, nach dem ein Hof in der Regel ungeteilt an einen einzigen Erben überging. Diese Regelung sicherte den Fortbestand der landwirtschaftlichen Betriebe, führte aber gleichzeitig dazu, dass nachgeborene Söhne erhebliche Schwierigkeiten hatten, eine eigene Existenz zu gründen. Da die Arbeit auf den Höfen sehr arbeitsintensiv war, konnten die Hoferben ihre Betriebe nicht allein bewirtschaften und waren auf zusätzliche Arbeitskräfte angewiesen. Diese beiden Faktoren – die Existenzsicherung für die nicht erbberechtigten Brüder und die Notwendigkeit der Arbeitsunterstützung – gelten als die klassischen Wurzeln des Heuerlingswesens.
Historische Quellen belegen jedoch, dass nicht nur soziale und familiäre, sondern auch betriebswirtschaftliche Gründe eine entscheidende Rolle spielten. In früheren Jahrhunderten lebten deutlich mehr Menschen auf den Höfen als heute. Die Unterkunftsmöglichkeiten waren vielfältig, aber oft notdürftig: Neben der bäuerlichen Großfamilie mit Mägden und Knechten fanden auch weitere Familien in Nebengebäuden wie Leibzuchten, Backhäusern, Speichern, Scheunen oder sogar Ställen und Böden Unterschlupf. Diese Wohnverhältnisse führten auf Dauer zu unhaltbaren sozialen Zuständen, da die wachsende Zahl an Bewohnern den Hof zunehmend überforderte. Die landwirtschaftlichen Betriebe konnten die dauerhafte Beschäftigung und Ernährung so vieler Menschen nicht mehr sicherstellen, was zu einer wirtschaftlichen und organisatorischen Herausforderung für die Bauern wurde.
Um diesem Problem zu begegnen, musste eine Lösung gefunden werden, die einerseits die Menschen vom Hof entfernte, sie aber nicht zu weit weg brachte, da ihre Arbeitskraft während der Arbeitsspitzen dringend benötigt wurde. Die Antwort auf dieses Dilemma war das Heuerlingswesen: Ein Teil des Hofes wurde ausgegliedert und einer Heuerlingsfamilie zur eigenen Bewirtschaftung überlassen. Damit war die Grundversorgung dieser Familie gesichert, während sie sich im Gegenzug verpflichtete, dem Bauern auf Abruf ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen.
Die Heuerlinge erhielten so die Möglichkeit, sich eine eigene kleine Existenz aufzubauen. Ihnen blieb es überlassen, durch Nebenerwerb ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Für den Bauern hingegen war das System mit erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen verbunden. Zwar musste er zunächst in den Bau eines Heuerhauses investieren, doch langfristig senkten sich seine Kosten erheblich. Die Heuerlingsfamilie war nicht mehr auf dem Hof unterzubringen und zu versorgen, es gab keinen Arbeitsleerlauf mehr, und die Arbeitskräfte standen flexibel zur Verfügung.
Diese Flexibilität war einer der größten Vorteile des Heuerlingswesens. Der Bauer konnte je nach Arbeitsaufkommen genau die benötigte Anzahl an Arbeitskräften abrufen – sei es eine Person, zwei oder sogar mehrere aus verschiedenen Heuerlingsfamilien. Die Anforderung erfolgte spätestens am Vorabend, in dringenden Fällen sogar sofort. War eine Heuerlingsfamilie nicht verfügbar, konnte eine andere einspringen. Dieses System erlaubte eine optimale Nutzung der Arbeitskraft und eine effiziente Steuerung von Arbeit und Produktion – ein Prinzip, von dem moderne Unternehmen nur träumen können.
Das Heuerlingswesen war somit eine pragmatische Lösung für ein grundlegendes Problem der damaligen Landwirtschaft: Es bot nicht erbberechtigten Söhnen eine Existenzmöglichkeit, sicherte den Höfen eine flexible und kostengünstige Arbeitskraft und stabilisierte damit die bäuerliche Wirtschaft auf dem Hümmling über Generationen hinweg.
abgeändert nach Dr. Günter Willenborg in Heimatblätter im Juni 1998