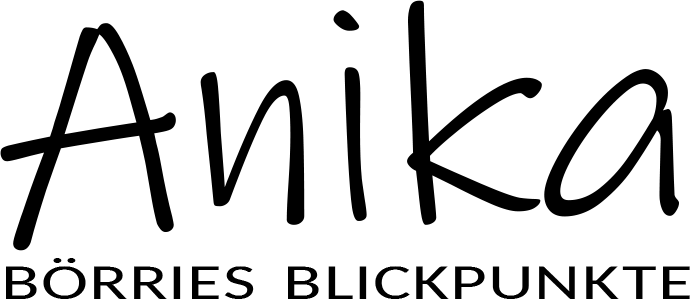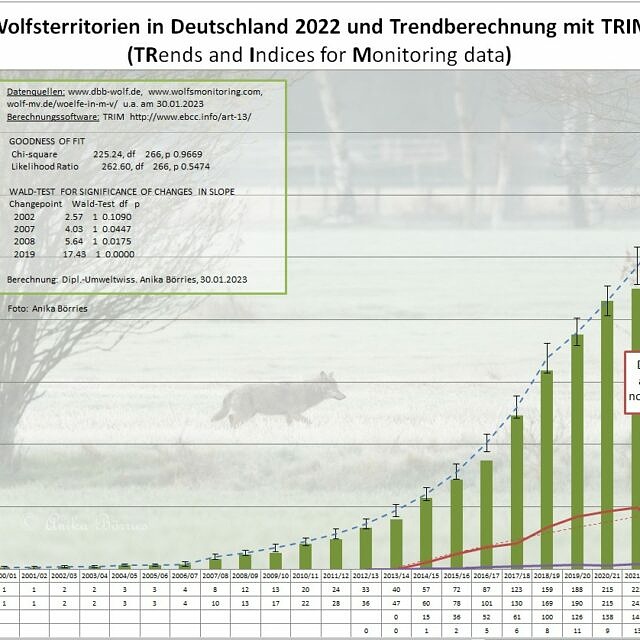Insektensterben in Deutschland: Was uns neue Studien über den dramatischen Rückgang der Artenvielfalt zeigen
Warum der Rückgang bei Schmetterlingen und Insekten Alarm auslösen sollte.

In unserem Garten erfreuen wir uns an einer beeindruckenden Vielfalt an Insekten, darunter die seltene Raupenfliege Tachina grossa. Solche Entdeckungen geben Hoffnung und zeigen, dass einige wertvolle Arten in naturnahen Gärten noch überleben. Doch umfassende Studien belegen, dass die Situation für viele Insektenarten in Deutschland insgesamt äußerst besorgniserregend ist. Mehrere zentrale Untersuchungen – die Krefeld-Studie, die Arbeit von Tschorsnig et al. (2019) sowie Analysen der Roten Listen – zeichnen ein düsteres Bild vom Zustand unserer Insektenwelt.
Der Rückgang der Insektenpopulationen in Zahlen
Die Krefeld-Studie, veröffentlicht im Jahr 2017, dokumentierte einen dramatischen Rückgang der Biomasse von Fluginsekten um etwa 76 % innerhalb von knapp drei Jahrzehnten. Dieser Rückgang betrifft nicht nur lokale Gebiete, sondern ist ein weit verbreitetes Problem mit tiefgreifenden Folgen für die Stabilität unserer Ökosysteme. Die Ergebnisse der Studie haben weltweit für Alarm gesorgt und verdeutlicht, wie drastisch die Insektenvielfalt abnimmt.
Die Untersuchung von Tschorsnig et al. (2019) ergänzt diese Erkenntnisse mit einer detaillierten Analyse der Raupenfliegen im Naturschutzgebiet Leudelsbachtal. Im Vergleich zu den 1970er Jahren konnten nur noch 13 % der damals dokumentierten Arten nachgewiesen werden. Diese dramatische Abnahme zeigt, dass selbst in geschützten Gebieten die Artenvielfalt erheblich bedroht ist.
Zusätzlich liefert eine Analyse der bundesweiten Roten Listen (Ries et al., 2019) noch beunruhigendere Zahlen: Von den 6.921 untersuchten Insektenarten in Deutschland wiesen 23 % in den letzten 10 bis 15 Jahren einen abnehmenden Bestandstrend auf, während nur 4 % eine Zunahme verzeichneten. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass der Verlust der Artenvielfalt in einem besorgniserregenden Tempo voranschreitet.
Ursachen des Rückgangs
Der Rückgang der Insektenpopulationen ist das Ergebnis mehrerer miteinander verknüpfter Faktoren, die oft in Kombination auftreten. Einer der zentralen Gründe ist der Verlust von Lebensräumen, der durch die Intensivierung der Landwirtschaft und die Verstädterung verursacht wird. Hecken, Wiesen und andere naturnahe Landschaftsstrukturen, die für Insekten lebenswichtige Rückzugs- und Nahrungsgebiete darstellen, verschwinden zunehmend. Vor allem die Umstellung auf großflächige Monokulturen und der Verlust von Wildblumen und Randstreifen haben den Lebensraum vieler Insekten drastisch eingeschränkt.
Ein weiterer wesentlicher Faktor ist der Einsatz von Pestiziden, insbesondere Neonikotinoiden. Diese systemischen Insektizide wirken gezielt auf das Nervensystem von Insekten und führen zu deren Tod. Problematisch ist, dass Neonikotinoide von Pflanzen aufgenommen und in Pollen und Nektar gespeichert werden, wodurch Bestäuber wie Bienen und Schmetterlinge ebenfalls betroffen sind. Studien zeigen, dass Neonikotinoide nicht nur Verhalten wie Orientierung und Fortpflanzung beeinträchtigen, sondern auch das Immunsystem schwächen, was Insekten anfälliger für Krankheiten macht.
Neonikotinoide verbleiben dazu auch lange in der Umwelt. Sie sind persistent und können mehrere Jahre im Boden nachgewiesen werden, was ihre Wirkung auf nicht-zielgerichtete Insekten und die umliegenden Ökosysteme verlängert. Beispielsweise wurde gezeigt, dass einige Neonikotinoide wie Imidacloprid und Clothianidin eine Halbwertszeit von bis zu 19 Jahren im Boden haben können. Diese lange Verweildauer bedeutet, dass selbst nach Beendigung ihrer Anwendung die negativen Auswirkungen auf Insektenpopulationen und Bodenorganismen bis zu 100 Jahre bestehen bleiben können. Aufgrund dieser Auswirkungen hat die EU den Einsatz bestimmter Neonikotinoide im Freiland eingeschränkt. Dennoch bleiben Pestizide und andere Umweltgifte eine ernsthafte Bedrohung für die Insektenvielfalt.
Auch der Klimawandel stellt eine zunehmende Bedrohung dar. Veränderte Temperaturmuster, verschobene Blühzeiten und Störungen im Gleichgewicht zwischen Pflanzen, Insekten und ihren Fressfeinden führen dazu, dass viele Insektenarten nicht mehr überleben können. Besonders stark betroffen sind Arten, die an spezifische Klimabedingungen angepasst sind.
Zusätzlich verschlechtern Umweltgifte wie Schwermetalle und Schadstoffe aus der Industrie die Lebensbedingungen für Insekten. Diese Schadstoffe reichern sich in Böden und Gewässern an und haben sowohl direkte als auch indirekte Auswirkungen auf die Gesundheit der Insekten und anderer Lebewesen in den Ökosystemen.
Warum das Insektensterben uns alle betrifft
Insekten sind das Fundament vieler Ökosysteme. Sie bestäuben Pflanzen, die einen Großteil unserer Nahrungsmittel produzieren, zersetzen organisches Material und sind eine unverzichtbare Nahrungsquelle für viele andere Tiere. Ihr Verlust gefährdet die Stabilität dieser natürlichen Kreisläufe. Ein massiver Rückgang der Insektenpopulationen bedeutet, dass auch die Landwirtschaft langfristig in Mitleidenschaft gezogen wird, was unsere Ernährungssicherheit bedroht.
Was wir tun können
Obwohl die Situation besorgniserregend ist, gibt es konkrete Maßnahmen, die jeder von uns ergreifen kann, um den Insektenrückgang zu verlangsamen oder sogar umzukehren. Ein Ansatz ist die naturnahe Gestaltung von Gärten und Balkonen. Indem wir heimische Pflanzenarten bevorzugen und auf den Einsatz von chemischen Mitteln verzichten, schaffen wir Lebensräume für Insekten. Pflanzen wie Wildblumen und Sträucher bieten Nahrung und Nistmöglichkeiten für Bestäuber wie Bienen, Schmetterlinge und Käfer. Auch das Anlegen von Blühstreifen oder Wildblumenwiesen kann in privaten Gärten oder öffentlichen Grünflächen wesentlich dazu beitragen, die Insektenvielfalt zu fördern.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist der Verzicht auf Pestizide. Selbst im Haus- und Gartenbereich eingesetzte chemische Mittel können erhebliche Schäden in Insektenpopulationen anrichten. Der Wechsel zu umweltfreundlichen Alternativen oder biologischen Pflanzenschutzmethoden schützt nicht nur Schädlinge, sondern auch Nützlinge wie Bestäuber und Räuberinsekten, die natürlicherweise Schädlinge kontrollieren.
Darüber hinaus ist es sinnvoll, ökologische Landwirtschaft zu unterstützen, indem man Lebensmittel aus biologischem Anbau bevorzugt. Diese Anbauweisen verzichten auf den Einsatz synthetischer Pestizide und fördern durch Fruchtfolge, Mischkulturen und den Erhalt von Hecken und Blühstreifen die Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen. Der Kauf von Bio-Lebensmitteln kann also einen direkten Beitrag zum Erhalt der Insektenvielfalt leisten.
Auch die Förderung von Biodiversität in der Landschaftsgestaltung ist von großer Bedeutung. Durch das Anlegen von Strukturen wie Totholzstapeln, Insektenhotels und Wildwiesen können wir Insekten Lebensräume bieten, die sie dringend benötigen. Solche Maßnahmen schaffen Nist- und Überwinterungsplätze und fördern damit den Erhalt von Bestäuberpopulationen sowie von Raubinsekten, die Schädlinge natürlich regulieren.
Diese Maßnahmen, die sowohl im privaten Bereich als auch in der Landwirtschaft umgesetzt werden können, sind Teil eines größeren Netzwerks von Lösungen, das notwendig ist, um die Insektenvielfalt langfristig zu schützen und die ökologischen Kreisläufe aufrechtzuerhalten, von denen auch wir Menschen abhängen.
Fazit
Die Ergebnisse dieser Studien sind ein deutlicher Weckruf. Der Rückgang von Schmetterlingen, Insekten und besonders von spezialisierten Arten wie der Raupenfliege Tachina grossa, die auf andere Arten angewiesen sind, zeigt, dass wir dringend handeln müssen. Es geht nicht nur darum, diese faszinierenden Lebewesen zu schützen, sondern auch darum, die ökologische Balance zu bewahren, auf die unser aller Wohlstand und Überleben angewiesen sind.
Quellen
- HALLMANN, C. A., SORG, M., JONGEJANS, E., SIEPEL, H., HOFLAND, N., SCHWAN, H., STENMANS, W., MÜLLER, A., SUMSER, H., HÖRREN, T., GOULSON, D., DE KROON, H. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE (12(10)), 1–21.
- MASON, R., TENNEKES, H., SÁNCHEZ-BAYO, F., JEPSEN, P. U. (2013): Immunsuppression durch neonikotinoide Insektizide an der Wurzel des globalen Rückgangs bei Wildtieren. Journal of Environmental Immunology and Toxicology 2013 (1), 3–12.
- RIES, M., REINHARD, T., NIGMANN, U., BALZER, S. (2019): Analyse der bundesweiten Roten Listen zum Rückgang der Insekten in Deutschland. Natur und Landschaft 94 (6/7), 232–244.
- SORG, M. (2013): Ermittlung der Biomassen flugaktiver Insekten im Naturschutzgebiet Orbroicher Bruch mit Malaise Fallen in den Jahren 1989 und 2013. Mitteilungen aus dem Entomologischen Verein Krefeld 2013 (1), 1–5.
- TSCHORSNIG, H.-P., HERTING, B., HASELBÖCK, A. (2019): Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae) des NSG Leudelsbachtal. Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart 54 (2), 45–52.